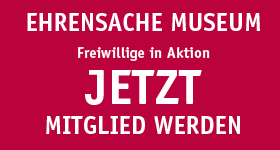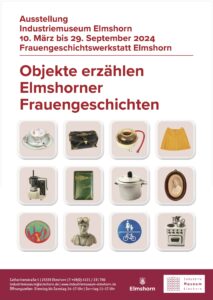Als der Bauer und Jäger Hermann Richter im August 1938 in einer Grube auf ein Geweih stieß, scheint er eine unbestimmte Ahnung über die Wichtigkeit seiner Entdeckung gehabt zu haben. Was er dem moorigen Boden „mit großer Umsicht und Sorgfalt“ entnahm, hatten paläolithische Rentierjäger ca. 10.000 – 15.000 Jahre zuvor mit Steinwerkzeugen bearbeitet, da ist sich Dr. Markus Wild sicher. Er ist Fachmann auf dem Gebiet der Geweihbearbeitungstechnik der ersten eiszeitlichen Sammler und Jäger Norddeutschlands, die ca. 12.500 v.Chr., unter anderem auch in der Gegend um Klein Nordende, temporäre Siedlungen bewohnten. Das heute vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiet sah während des Spätpaläolithikums ganz anders aus: eine weitflächige Tundra mit vereinzelten Birken erstreckte sich über das Land und endete stellenweise abrupt vor einer bis zu 300 Meter hohen Gletscherwand des skandinavischen Inlandeises.
Kein gewöhnliches Geweih
Dr. Markus Wild und Doktorand Tobias Reuter, der sich intensiv mit dieser archäologischen Fundregion beschäftigt hat, ist die Begeisterung anzumerken. „Es handelt sich hier mit großer Wahrscheinlichkeit um ein seltenes Exemplar der frühesten bekannten Beilform, dem ‚Lyngby Beil‘.“
Besonders fasziniert die Wissenschaftler aus dem Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie im Schloss Gottorf der Einblick in den Herstellungsprozess, den die Bearbeitungsspuren ermöglichen. „Das Beil wurde scheinbar nicht fertig gestellt. Die Eissprosse, aus der sonst das Profil des Werkzeugs hergestellt wird, ist abgesplittert. Dadurch wurde es vermutlich unbrauchbar und landete in einem See, auf dessen Grund es durch chemische Prozesse konserviert wurde.“

Dr. Markus Wild deutet auf die abgesplitterte Eissprosse. Bild IME
Die Anzahl der bisher gefundenen Beile dieser Art ist an zwei Händen abzuzählen, jedes unerforschte Exemplar ist für die Wissenschaftler*innen somit von großer Bedeutung.
Dies gilt noch mehr für ein weiteres Objekt, das bei Nachgrabungen an der Fundstelle des Lyngby Beils gesichert wurde. Es handelt sich dabei um das ungefähr 18,5 Zentimeter lange Teilstück eines gespaltenen Rentiergeweihs mit der Inventarnummer A-1102. Das besondere Merkmal ist hier ein mit Steinwerkzeugen angespitztes Ende. In historischen Zeitungsartikeln wurde dieses gelegentlich vorschnell als „Speerspitzenbruchstück“ bezeichnet. Über die tatsächliche Funktion sind sich die Forscher heute allerdings nicht sicher. Vermutlich diente das Geweihstück eher als Werkzeug bei der Materialverarbeitung, da Pfeil und Bogen bereits bekannt und als Waffe deutlich effektiver waren.
Erkenntnisse dazu stammen unter anderem von der bedeutenden Fundstelle im Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal. Das „Tal der Rentierjäger“ ist nicht nur die europaweit größte Fundstelle steinzeitlicher Rentierkadaver, auch die ältesten Pfeile der Welt stammen aus dem heutigen Naturschutzgebiet nordwestlich von Hamburg.

Die rätselhafte Spitze aus Rentiergeweih war vermutlich ein Werkzeug, keine Waffe. Bild IME
Beprobung soll neue Erkenntnisse bringen
Aufgrund der Seltenheit der Funde bearbeiteter Geweihstücke bietet eine Radiokohlenstoffdatierung die spannende Möglichkeit, genauere Erkenntnisse über die zeitliche Einordnung der Pioniere des Nordens zu bekommen. Bei dieser „destruktiven“ Methode wird eine Probe von 500mg des Kollagens entnommen. Durch unterschiedliche Verfahren wird der Gehalt des Isotops 14C untersucht, was Rückschlüsse auf das Alter des Objekts zulässt. Die ca. 4mm breite Bohrung wird an einer unauffälligen Stelle vorgenommen, um die Ästhetik des Objekts nicht zu beschädigen. Durch entsprechende Füllmassen kann der visuelle Makel bei Bedarf auch gänzlich behoben werden.
–
Über die aus der Begutachtung und Datierung erfolgten Erkenntnisse werden wir Sie natürlich informieren.
Die Objekte sind zur Zeit leider nicht im Museum zu sehen.